Die Erhebungen von IGES DKG und Co hinsichtlich Ambulantisierungspotential sind jedem bekannt. Die demographische Entwicklung hinsichtlich der Patientenseite mit kontinuierlich mehr Inanspruchnehmenden sowie die Effekte durch Renteneintritt der Boomer auf der Seite der Leistungserbringer führen zu einem Ungleichgewicht. Hinzu krankt das „alte“ System an nahezu jeder Ecke. Krankenhäuser befinden sich in einem Vakuum ohne klare Perspektive, sicheren Boden gibt es nur in wenigen Bereichen. Klar ist, dass eine relevante Anzahl der klassischen Krankenhausfälle in Zukunft ambulant oder hybrid erbracht werden muss. Das bedeutet erst einmal eine deutlich reduzierte Vergütung bei gleichen Kosten und gleichem Prozess. Hinzu kommen die Effekte durch das KHVVG und die damit verbundene Schließung oder Umwidmung von Krankenhäusern, flankiert von Investitionsstau und Personalmangel in nahezu allen Bereichen. Auf der anderen Seite der Sektorgrenze sieht es nicht besser aus. Der EBM ist seit Jahren unterfinanziert, während man vor einigen Jahren im EBM durch eine hohe Prozessqualität noch wirtschaftlich arbeiten konnte und das sicherlich auch heute noch in einzelnen Bereichen funktioniert, sind die Kosten dermaßen gestiegen, dass auch hier eine Vielzahl an Herausforderungen bestehen. Insbesondere für operativ tätige Ärzte oder Betreiber von OP-Zentren. Neben dem allgemeinen Kostenanstieg beim Invest, einer Ausweitung der Anforderungen durch Aufsichtsbehörden sowie der generellen Problematik bei der Nachfolge konkurrieren diese inzwischen auch mit den Krankenhäusern um die begrenzte Ressource Personal hinsichtlich MFA OTA und vielen weiteren. Fakt ist, dass immer mehr Versorgung rund um die noch existente Sektorgrenze des „alten“ Systems herum organisiert werden muss.
Aus meiner Sicht werden Krankenhäuser einen signifikanten Teil dieser ambulant-hybriden Versorgung übernehmen müssen. Insbesondere im operativen Bereich, da die vorhandenen Strukturen eher rückläufig sind, die Betreiber der Zentren gehen in Rente, eine Nachfolge ist nicht in Sicht. Eine Neugründung, Bau und Ausstattung eines operativen Zentrums heute sind nur selten refinanzierbar und als relevante neue Säule der Versorgung nicht zu erwarten. Letztlich wird es nur gemeinsam gehen, die Erfahrung der Praktiker des ambulanten Bereichs wird benötigt, ebenso wie die Kernkompetenz und die gute Ausstattung des Krankenhauses als Backup. Man ist gut beraten, wenn beide Seiten kooperieren würden, das macht Sinn bei der Primärversorgung in Regionen, wo klassische Krankenhäuser geschlossen oder zu 1n oder 1i umgewidmet wurden. Hier muss der Gesetzgeber den Weg frei machen für unkomplizierte Kooperationsmodelle und den gemeinsamen Betrieb in der ehemaligen Krankenhaushülle. Geförderte Pilotprojekte müssen pragmatisch umgesetzt, evaluiert und systematisch in die Regelversorgung überführt werden. Hier muss man vom Bedarf und vom Prozess her kommen und nicht die Theorie bemühen.
Ein prominentes Beispiel ist die intersektorale Versorgung operativer Patienten, also ein OP-Areal und eine Möglichkeit zur stationären Aufnahme. Hier gibt es seit Jahrzehnten Praxiskliniken, die diesen Job hervorragend machen. Qualitativ und wirtschaftlich. Leider ohne Zulassung und somit auch ohne die Möglichkeit zur Abrechnung stationärer GKV Patienten. Über eine § 30 Privatkrankenanstalt nach GewO haben diese eine Station, die sämtliche Kriterien erfüllt, die auch eine Krankenhausstation erfüllen muss. GKV Patienten können allerdings nur über besondere Versorgungsverträge stationär behandelt werden, oft zum Missfallen der Patienten. Durch die Hybrid DRG haben viele Betreiber einer Praxisklinik auf die lang ersehnte Option zur Abrechnung stationärer Leistungen gehofft und wurden enttäuscht. Diese ist lediglich Krankenhäusern vorbehalten und die ganze Hybrid DRG lediglich ein Transfermedium in Richtung EBM und wird die flächendeckende Versorgung mit diesen intersektoralen patientenzentrierten Strukturen nicht hervorbringen. Obwohl der Bedarf aus meiner Sicht genau für diese vornehmlich ambulanten hoch effizienten und hoch qualitativen Zentren mit einem stationären Backup auf niedrigem pflegerischem Niveau größer denn je ist, wir brauchen alles was wir kriegen können. Allerdings nicht willkürlich, sondern nach klaren Zulassungskriterien. Es muss eine Hürde der Zulassung geben und klare Vorgaben, die Ernsthaftigkeit und kaufmännische Abwägung erfordern.
Positionen und Lösungsperspektive
Im aktuellen Diskurs zeigen sich die Fronten. Klinikträger und Krankenkassen fordern sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen, die kleineren Häusern eine Zukunft sichern sollen, ausgestattet mit ambulanter Leistung und Übernachtungsmöglichkeit, finanziert durch Transformationsmittel. Die Deutsche Praxisklinikgesellschaft kritisiert dagegen, dass Praxiskliniken und ambulante OP-Zentren, die seit Jahrzehnten genau diese Versorgung erfolgreich leisten, übergangen werden. Statt Milliarden in Klinikumbauten zu stecken, sollte konsequent in funktionierende ambulante Strukturen investiert werden. Gleichzeitig wird die Fortführung der Trennung von EBM und DRG als Blockade empfunden, wo eigentlich echte Hybrid-DRGs nötig wären.
Auch der frühere Gesundheitsminister Lauterbach hat beim DRG-Forum 2023 betont, er wolle keine dritte Struktur im System, sondern die Krankenhäuser in den Mittelpunkt der Ambulantisierung stellen. Doch dieser Blick auf Sektorengrenzen verstellt die eigentliche Aufgabe. Wir sollten nicht mehr in Sektoren denken, sondern in Versorgung. Entscheidend ist, dass für den operativen Bereich Strukturen entstehen, die nach klaren Kriterien zugelassen sind, die nicht leicht zu erfüllen sind, die aber Ernsthaftigkeit und kaufmännische Abwägung voraussetzen. So entstünde im Sinne der Patienten ein sinnvolles Modell, das Qualität und Verlässlichkeit sichert.
Reine Praxiskliniken existieren ohnehin nur in kleiner Zahl. Krankenhäuser sollten von deren Strukturen lernen und Allianzen schmieden, statt die Unterschiede zu betonen. Der Streit darüber, wer mehr Anspruch auf Ambulantisierung hat, kostet Energie und führt zu Stillstand. Wichtiger ist es, gemeinsam voranzukommen.
Fazit
Wir sollten die Energie nicht in Grabenkämpfe investieren, sondern in Lösungen. Ob operative Zentren, Primärversorgung, integrierte Notfallzentren oder künftige sektorenübergreifende Modelle – das Ziel ist eine Versorgung, die die Patienten in den Mittelpunkt stellt, Prozesse effizient organisiert und Fachkräfte entlastet. Nur wenn wir den Streit hinter uns lassen und die Stärken beider Seiten verbinden, entsteht ein System, das tragfähig, wirtschaftlich und zukunftssicher ist.


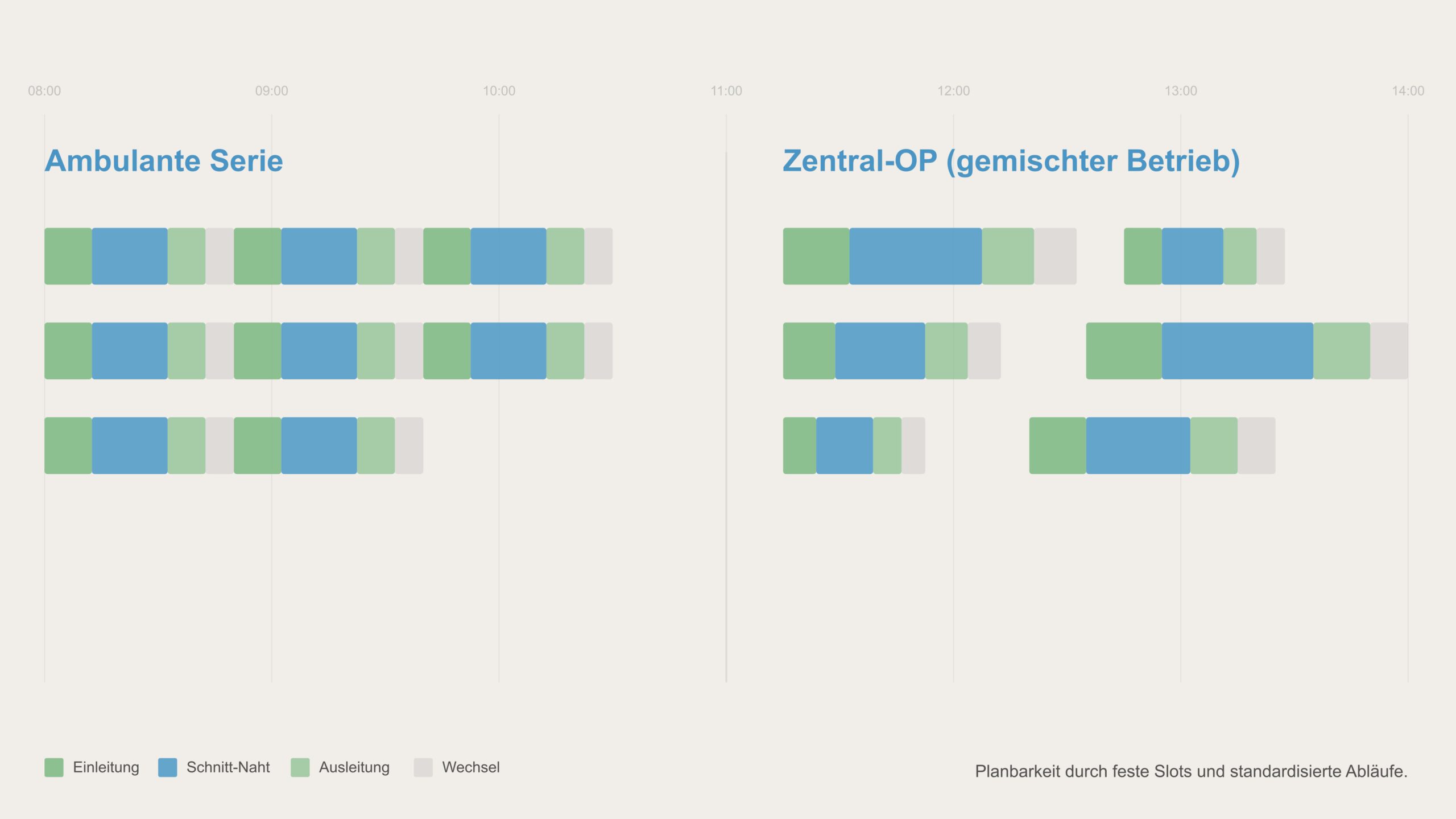
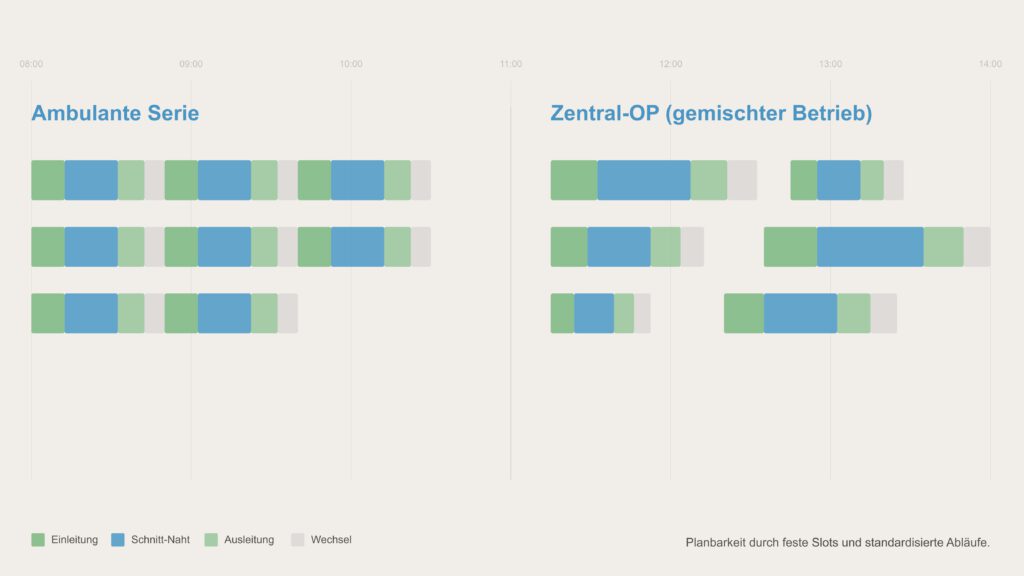
Schreibe einen Kommentar