
Im Klinikum Sonnenhöhe (Akutkrankenhaus mit breitem elektivem Portfolio) laufen aktuell drei Entwicklungen gleichzeitig auf: Immer mehr planbare Leistungen wandern in ambulante Settings, neue Vergütungslogiken machen die Setting-Entscheidung wirtschaftlich relevanter als je zuvor, und die bestehende ambulante Struktur ist über Jahre organisch gewachsen – mit mehreren MVZ-Sitzen, verteilt über Standorte und Etagen, unterschiedlichen Prozessen, uneinheitlicher Terminlogik und ohne eine zentrale Instanz, die Indikation, Setting und Abrechnung konsequent zusammenführt.
Was nach „Ambulantisierung“ klingt, ist in Wahrheit ein Betriebsmoment: Wenn planbare Fälle nicht sauber gesteuert werden, entstehen Reibungsverluste an genau den Stellen, an denen Kliniken heute ohnehin unter Druck stehen – in der Bettenbelegung, im OP, in der Abgrenzung und im Patientenerlebnis. Das Klinikum Sonnenhöhe hat diese Dynamik nicht als Zukunftsthema behandelt, sondern als akutes Risiko: steigende Prüf- und Abgrenzungsrisiken bei Grenzfällen, stationäre OP-Kapazitäten werden durch Fälle gebunden, die künftig ambulant oder hybrid gehören, und planbare MVZ-Fälle gehen an Wettbewerber verloren, weil Terminierung, Wegeführung und Wartezeiten nicht mehr konkurrenzfähig sind.
Der Vorstand hat daraus eine sehr klare Konsequenz gezogen: Es geht nicht darum, ein neues Gebäude zu errichten. Es geht darum, einen steuerbaren Behandlungspfad zu bauen.
Das Zielbild: eine „Eingangstüre“ für planbare Fälle
Auf dem Klinikcampus entsteht deshalb „CampusAmbulant“ als ambulantes Zentrum, das die planbaren Fälle strukturiert aufnimmt und entlang eines definierten Pfades führt. Dazu gehört die Bündelung der MVZ-Sitze (Fachärzte, Diagnostik, Prämed, Nachsorge), ein ambulantes OP-Zentrum inklusive perioperativer Infrastruktur, eine belastbare Struktur für Hybrid-DRGs und perspektivisch planbare aDRGs – und vor allem: Fallsteuerung als Kernfunktion, die dafür sorgt, dass der richtige Patient im richtigen Setting landet und die Dokumentation von Anfang an abrechnungs- und prüfsicher gedacht wird.
Damit wird „ambulant“ nicht zum Nebenschauplatz des Krankenhauses, sondern zur bewussten Eingangstür für alles, was planbar ist.
Fallsteuerung als Betriebssystem – nicht als Telefonzentrale
Der zentrale Designfehler vieler ambulanter Campusprojekte ist, Fallsteuerung als Koordinationsstelle zu verstehen. In Sonnenhöhe wird Fallsteuerung als Entscheidungskette aufgebaut, die medizinische, prozessuale und abrechnungslogische Kriterien zusammenbringt. Es geht also nicht nur darum, „jemanden ans Telefon zu setzen“, sondern darum, eine robuste Logik zu etablieren: Welche Indikation gehört unter welchen Bedingungen in welches Setting – und welche Mindestanforderungen an Diagnostik, Prämedikation, Überwachung, Notfallpfad und Dokumentation müssen erfüllt sein?
Diese Logik beginnt mit einer integrierten Indikations- und Setting-Entscheidung. Medizinisch spielen beispielsweise Risiko, Komorbidität, ASA und soziale Faktoren eine Rolle. Prozessual geht es um Überwachungsbedarf, Infrastruktur und den geübten Notfallpfad. Abrechnungslogisch muss von Anfang an klar sein, ob ein Fall in AOP/EBM/GOÄ, Hybrid-DRG, aDRG, Tagesklinik oder ASV geführt wird – und welche Dokumentationsbausteine dafür zwingend sind. Darauf aufbauend steuert das Zentrum den Pfad: Diagnostik und Prämed werden vor den OP-Termin gezogen und standardisiert, die OP-Planung trennt ambulante OP-Prozesse sauber vom stationären Betrieb, und die Nachsorge ist kein „danach irgendwie“, sondern ein definierter Teil des Pakets – MVZ, Pflege, Telemedizin oder Wiedervorstellung, je nach Fall.
Entscheidend ist: Dokumentation und Abrechnung sind nicht das Ende, sondern werden als „Ready-Standard“ mitgeführt – über Templates, Checklisten und klare Verantwortlichkeiten zwischen Operateur, Anästhesie, MVZ und Klinikabrechnung. Das Ziel ist nicht Bürokratie. Das Ziel ist Stabilität: medizinisch sauber, wirtschaftlich robust und für den Patienten spürbar besser.
Die Patient Journey – warum sich das im Alltag auszahlt
Nehmen wir Herr K., 52 Jahre, berufstätig, Kniearthroskopie. Im alten Modell wäre er nicht selten stationär aufgenommen worden – nicht, weil es medizinisch nötig ist, sondern weil es im Alltag „einfacher“ wirkt: weniger Schnittstellen, weniger Abstimmung, weniger Risiko, dass etwas fehlt. Genau dieses „einfacher“ wird jedoch teuer, wenn die Leistungslogik sich ändert, OP-Kapazitäten knapp sind und Abgrenzungsrisiken steigen.
Im neuen Modell startet Herr K. im orthopädischen MVZ im CampusAmbulant. Indikation, Aufklärung und Bildgebung laufen dort gebündelt. Die Fallsteuerung prüft früh: low risk, planbar, keine sozialen Hürden, keine Gründe für stationäre Überwachung. Daraus folgt nicht nur „ambulant“, sondern die konkrete Frage: passt Hybrid-Logik (aktuelle noch nicht verfügbar) oder klassisch AOP? Anschließend erfolgt die Prämedikation im Zentrum – mit klaren Slotplänen, standardisierten Checklisten (Medikation, Blutwerte, Begleitperson, Transport) und einer verbindlichen OP-Freigabe. Der OP selbst läuft im ambulanten / selektiven OP-Zentrum mit definiertem Tagesprozess von Aufnahme bis Entlassung; der Notfallpfad auf dem gleichen Campus ist geregelt und geübt, nicht nur theoretisch vorhanden.
Nachsorge, Wundkontrolle und Heilmittelkoordination erfolgen wieder im MVZ. Arbeitsunfähigkeitsmanagement ist integriert, Zuständigkeiten sind klar. Und: die Dokumentation ist so geführt, dass die Abrechnung nicht „irgendwie klappt“, sondern von Anfang an wasserdicht ist.
Für den Patienten bedeutet das ein spürbar besseres Erlebnis: schneller Termin, kurze Wege, klare Zuständigkeiten, alles aus einer Hand. Für die Klinik bedeutet es freie stationäre Kapazität für komplexere Fälle, weniger Prüfrisiken und ein planbares Portfolio mit stabilen Prozessen.
Betreibermodelle: Die eigentliche Weichenstellung
Spannend ist: Das Klinikum steht nicht nur vor der Frage, wie das Zentrum aussieht, sondern wer es wie betreibt. Realistisch sind vier Modelle.
Ein Inhouse-Modell (100% Krankenhaus/MVZ GmbH) bietet maximale Steuerbarkeit. Strategie, Kapazität und Prozesse bleiben in einer Hand, Abrechnungskompetenz und Compliance lassen sich zentral führen, und Fallsteuerung kann als „Single Point of Truth“ etabliert werden. Der Preis dafür ist, dass Krankenhauslogik ambulante Effizienz bremsen kann und Arztbindung aktiv über Anreize gestaltet werden muss.
Ein Joint Venture mit Ärzten oder Partnern kann Arztbindung und ambulantes Unternehmertum stärken und in bestimmten Fachrichtungen einen schnellen Marktzugang ermöglichen. Gleichzeitig wird Governance komplex: Investitionen, Personal, Preise und Zuweisungen werden politischer. Fallsteuerung gerät schnell in Konflikte („wer bekommt welche Fälle?“). Und die Abgrenzung Krankenhaus/JV muss extrem sauber geregelt sein.
Ein Management- oder Betreibervertrag mit einem professionellen Dritten kann Tempo bringen und Know-how transferieren. Er birgt jedoch Abhängigkeiten und Kulturkonflikte – und vor allem darf Fallsteuerung trotzdem nicht ausgelagert werden. Die Hoheit über Setting-Logik und Abgrenzung muss beim Eigentümer bleiben.
Ein reines Miet-/Flächenmodell reduziert operatives Risiko und kann schnell realisiert werden. Für das Kernziel von Sonnenhöhe – Steuerung, Kapazitätsentlastung, Erlössicherung über richtige Settings – ist es jedoch das schwächste Modell, weil echte Fallhoheit und AOP/Hybrid/aDRG-Logik in fremde Hände wandern.
Jedes Modell muss regional genau betrachtet werden.
Empfehlung im Case: Inhouse als Basis – selektives JV als Turbo
Im Case „Sonnenhöhe“ ist das empfohlene Zielbild deshalb klar: Modell A als Basis, ergänzt um selektive JV-Elemente dort, wo es strategisch Sinn macht. Der Grund ist simpel: Fallsteuerung, Hybrid/aDRG-Abgrenzung, Campus-Notfallpfad und MVZ-Bündelung verlangen hohe Prozess- und Governance-Klarheit. Das gelingt am stabilsten, wenn eine Organisation Kapazitäten und Pfade steuert und Dokumentations- sowie Abrechnungsstandards aus einem Guss kommen.
JV-Elemente können in einzelnen Fächern als Turbo wirken – zum Beispiel in Orthopädie oder HNO – aber nur, wenn Fallsteuerung als neutrale Instanz vertraglich geschützt ist, klare Zuweisungs- und Abrechnungsregeln existieren und Interessenkonflikte aktiv gemanagt werden.
Fazit: Erst Betriebssystem, dann Bau
CampusAmbulant ist im Kern kein Architekturthema. Es ist ein Betriebssystem-Thema. Wer zuerst Flächen plant und erst später die Falllogik, baut am Ende schöne Räume für alte Prozesse. Wer hingegen zuerst die Entscheidungskette stabil macht – Indikation, Setting, Pfad, Dokumentation – schafft eine Eingangstüre, die den Klinikbetrieb wirklich entlastet und ambulante Leistungserbringung steuerbar macht.
Wenn du aus diesem fiktiven Case eine Lehre ziehen willst, dann diese: Ambulante Zentren scheitern selten am Bau. Sie scheitern daran, dass niemand eindeutig entscheidet, welcher Patient wohin gehört – und dass diese Entscheidung nicht konsequent im Betrieb verankert ist.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.





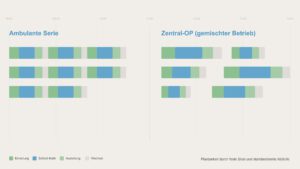
Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!